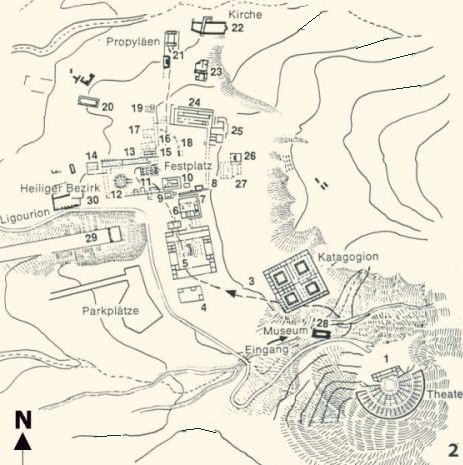Epidauros
Geschichte:
Im Altertum verehrte man hier den Gott Asklepios, der Sage nach ein
Sohn des Apoll und Koronis, der Tochter des Königs Phlegyas von
Orchomenos. Als Koronis bei der Geburt starb, nährte eine Ziege
Asklepios. Beim Kentauren Chiron wuchs der Gott auf, der ihn in der
Heilkunde unterwies. Asklepios ist aber auch eine chthonische
Gottheit, eng mit der Erde verbunden, wieauchseinSymbol.dieSchlange,
bezeugt. In Epidauros wurde er zusammen mit Apollon Maleatas verehrt,
einer lokalen Erscheinungsform des Apoll, der wiederum eine ältere
Gottheit, Maleatas, verdrängt hatte. Die ältesten Reste des
Heiligtums stammen aus dem 6. Jh. v.Chr. Berühmt wurde das
Heiligtum Ende des 4. Jh. Von ganz Griechenland strömten die
Kranken dorthin, um Heilung zu erbitten. Nach verschiedenen
Reinigungsriten mußten die Kranken eine Nacht im Abaton
verbringen, wo ihnen der Gott im Schlaf erschien und die
entsprechende Therapie anzeigte. Alle vier Jahre fanden
panhellenische Spiele, die Asklepieia, statt mit musischen und
sportlichen Wettkämpfen, die aber nie die Berühmtheit der
Olympischen oder Delphischen Spiele erreichten. Im Jahre 426 n. Chr.
wurde das Heiligtum von Kaiser Theodosius II. geschlossen. Die
Ausgrabungsarbeiten führten die griech. Archäologen
Kavadias und Papadimitriou im Heiligtum des Maleatas (1948-1951)
durch.

Das
Theater: Es ist das besterhaltene und bekannteste der Antike und
wird auch heute noch für Aufführungen benutzt. Gebaut wurde
es höchstwahrscheinlich zu Beginn des 3. Jh. v. Chr. Anfangs
hatte es 34 Sitzreihen aus Kalkstein und war in zwölf Sektoren
geteilt. Eine Erweiterung fand im 2. Jh. v. Chr. statt, wobei man 21
weitere Sitzreihen anbaute und sich das Fassungsvermögen von
6200 auf 12 000 Zuschauer erhöhte. Die Ehrengäste saßen
in der ersten Reihe (Prohedrie), die aus Sitzen mit Rückenlehne
bestand. Die Orchestra besaß einen Boden aus gestampftem
Lehm, hatte einen Durchmesser von 20,30 m und eine niedrige
Marmoreinfassung. In der Mitte stand der Altar des Dionysos
(heute nur das Fundament erkennbar). Zwei Parodoi (Zugänge)
führten zur Orchestra; der westliche ist aus Teilen beider
wiederaufgebaut und besaß - wie auch der östliche - eine
verschließbare Tür. Hinter der Orchestra die Skene
(Bühnenhaus) mit vier Innenstützen und je zwei Kammern an
den Seiten. Das Proskenion (Vorderbühne) war 22m lang und
2,17 m breit und besaß zwei Flügel, die an den Seiten
hervortraten. Die Fassade wies vierzehn ionische Halbsäulen auf;
dazwischen waren drehbare Holztafeln (Periakta) mit bemalten
Bühnenbildern angebracht. Später, als nicht nur die
Schauspieler, sondern der Chor in der Orchestra auftrat, wurden die
Periakta an den Wänden der Skene angebracht Nach dem Einfall der
Goten 267 n. Chr., die das Heiligtum und das Theater zerstörten,
wurde es neu errichtet. Dabei wurden auch Bauteile vom Heiligtum
verwendet.
|
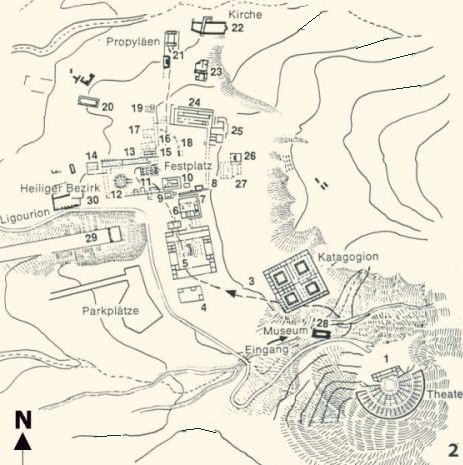
|
1.Theater
2.Apollon Maleatas
3.Katagogion
4.Badehaus
5.Gymnasion (Römisches Odeion)
6.Palaistra
7.Halle
des Kotys
8.Tempel der Themis
9.Tempel der Artemis
10.Altes Abaton
11.Tempel des Asklepios
12.Tholos
13.Neues Abaton
14.Römisches Brunnengebäude
15.Brunnen
16.Bibliothek
17.Badeanlage
18.Festplatz
19.Aphrodite-Tempel
20.Zisterne
21.Propylaia
22.Frühchristliche Basilika
23.Römische Villa
24.Dorische Säulenhalle
25.Römische Thermen
26.Epidoteion (?)
27.Römische Villa
28.Museum
29.Stadion
|
Heiligtum
des Apollon Maleatas (ca. 15 Min. Aufstieg vom Theater aus): Der
Ort war schon im 3. Jtd. besiedelt. Man fand Reste eines
Brandopferaltars aus dem 7. Jh. v. Chr. Anfang des 4. Jh. wurde ein
kleiner Tempel errichtet, und gegen Ende des Jh. kam eine Stoa mit 17
oder 19 Säulen hinzu, die durch Strebepfeiler abgestützt
wurde. Aus römischer Zeit existieren ein Brunnen, eine Zisterne
und ein Haus für die Priester. Stifter war laut Pausanias der
Senator Antoninus, der von Asklepios geheilt worden war.
Katagogion:
Vom Theater aus und am Museum vorbei, kommt man zuerst zum Gästehaus,
Xenon oder auch Katagogion genannt. Es ist ein quadratischer Bau
(76,30 x 76,30 m) des 4. Jh. und beherbergte die Reisenden. Es besaß
160 Räume in zwei Stockwerken, die um vier Höfe mit
dorischen Säulen angeordnet waren.
Griech.
Bad (w davon): Ruinen einer Anlage aus dem 3. Jh. v. Chr.
Gymnasion
(an der N-Seite anschließend): Ein großer Bau (76 x 70 m)
auf noch sichtbaren Tuffsteinsockeln. In seiner ursprünglichen
Gestalt besaß er einen Innenhof, von 60 Säulen umgeben,
Hallen und Räume in den Ecken. Der Eingang (NW) hatte ein
Propylon mit sechs dorischen Säulen. In römischer Zeit
wurde das Propylon in ein Hygieia-Heüigtum, der Innenhof in ein
Odeion umgewandelt.
Palästra
(n des Gymnasions): Ein fast quadratischer Bau (34,20 x 29,35 m) mit
Räumen an drei Seiten und einer Stoa an der N-Seite. Die
Außenmauern bestehen aus behauenen Steinen. Die Stoa wird mit
der Stoa des Kotys identifiziert, das Gebäude wird als Palästra
angesehen.
Artemis-Tempel
(13,30 x 9,40m): Er wurde Ende des 4. Jh. erbaut und wies sechs
dorische Säulen an der Front und zwei vor den Anten auf. In der
Cella stand das Kultbild, von zehn Säulen umgeben.
Themis-Tempel
(fast an die Stoa des Kotys anschließend): Er stammt ebenfalls
aus dem 4. Jh., mißt 7,25 x 4,85 m und hatte zwei Eingänge,
einen im Osten und einen im Westen.
Tempel
des Asklepios und des Apollon der Ägypter (NO): Er wurde in
römischer Zeit von Antoninus errichtet. An der S-Seite eine
Villa mit zwei Atrien. Im Heiligen Bezirk, der von Grenzmalen umgeben
war, und n des Artemis-Tempels ein viereckiger Bau (24,30 x 20,70 m),
der älteste des Heiligtums. An seiner NW-Ecke befanden sich ein
Tempel und ein Altar des Apoll. In der Mitte des 6. Jh. v. Chr. fand
der Bau als Schlafraum Verwendung. Es könnte sich um das ältere
Abaton handeln, wo Asklepios den Heilsuchenden im Traum erschien. In
römischer Zeit diente es den Priestern als Wohnhaus. Im W dieses
Baus gab es einen Altar, der Apoll geweiht war.
Asklepios-Tempel:
Dorischer Peripteros (24,30 x 13,20 m), aus Tuffstein gebaut.
Architekt war Theodoros aus Phokäa. Der Fußboden war mit
Tuffsteinplatten ausgelegt. Die Kultstatue aus Gold und Elfenbein war
ein Werk des Thrasymedes aus Paros und entstand um 350 v. Chr. Sie
befand sich in einer Vertiefung in der Cella (0,50 m unterhalb des
Bodenniveaus). Die Akroteren wie auch die Giebelfiguren entstanden
nach Modellen des Bildhauers Timotheos (390/380).
Tholos
(w desAsklepios-Tempels): Von dem Bau ist nur das Untergeschoß
(21,28 m Durchmesser) erhalten. Er gilt als ein Werk Polyklets des
Jüngeren (gegen 360 v. Chr.). Es ist ein Rundbau, der aus sechs
konzentrischen, runden Mauern bestand, wobei die ersten drei
durchlaufend waren, die weiteren drei jedoch von Toren durchbrochen
und mit Querwänden untereinander verbunden. Die äußere
Mauertrug 26 dorische, die dritte von außen 14 korinthische
Säulen. Die Tür befand sich im Osten und wies reichen
Skulpturenschmuck (im Museum) auf. Die Kassettendecke trug ein
pflanzliches Dekor. Der Fußboden war mit schwarz-weißen
Platten ausgelegt und hatte in der Mitte eine runde Öffnung, die
mit einer Platte zugedeckt war. Durch diese Öffnung konnte man
in das Untergeschoß gelangen. Die genaue Verwendung des Baus
ist nicht bekannt. In der Kostenaufstellung, die sich im Museum
befindet, wird er als Thymele (Opferstätte) angeführt. Es
wird auch vermutet, daß im Untergeschoß die heiligen
Schlangen des Asklepios aufbewahrt wurden.
Abaton
(n des Tholon): Eine Säulenhalle von 70 m Länge und 9,50 m
Breite mit 29 ionischen Säulen an der Fassade und 13
Innensäulen. Der W-Teil besaß infolge des starken Gefälles
zwei Stockwerke. Der 0-Teil, der auch älter ist (4. Jh.), war
einstöckig. Durch 14Stufen waren die beiden Stockwerke
miteinander verbunden. Ö des Abatons ein Brunnen aus dem 6. Jh.
v. Chr. mit einer Tiefe von 17 m. In der Nähe befanden sich
Inschriftentafeln, die sogenannten Pinakes, aufgestellt (jetzt
im Museum), auf denen Heilungen beschrieben waren.
Brunnenhaus
(w des Abatons und außerhalb des Heiligen Bezirks): Es ruht auf
einem Tuffsteinfundament aus klassischer Zeit und war in kleine Räume
unterteilt, die vielleicht als Wasserbehälter dienten. An den
NO-Teil des Abatons grenzten eine Bibliothek (S) und eine
Thennenanlage (N) aus dem 2. Jh. v. Chr., die auf die Fundamente
älterer Bauten errichtet wurden.
Stoa
(weiter nö): Langgestreckte Anlage aus dem 3. Jh. v. Chr.
Thermen
(an der 0-Seite der Stoa): Die Anlage stammt aus römischer Zeit.
Die Ziegelmauem haben sich bis zu einer Höhe von 1-2 m erhalten.
Der mittlere Raum hatte vier Säulen und besaß einen
Mosaikfußboden. Bevor der Bau in eine Thermenanlage umgewandelt
wurde, soll er eine große Zisterne gewesen sein, die das
Heiligtum mit Wasser versorgte. S ein Gebäude mit Stoa, das
Epidoteion, das im 4. Jh. errichtet und im 2. Jh. n. Chr. erneuert
wurde. Reste eines kleinen Aphrodite-Tempels w der langgestreckten
Stoa aus dem Ende des 4. Jh. Eine Villa aus dem 5. Jh. v. Chr. befand
sich n der Stoa (geringe Spuren zu sehen).
Propyläen
(w des kleinen Aphrodite-Tempels): Sie wurden 340-330 errichtet. Zu
sehen sind noch die Rampen an den Schmalseiten. Eine frühchristlicher
Basilika (4. oder 5. Jh.) lag ö der Propyläen und war
mit schönen Mosaiken ausgelegt.
Stadion
(w des Gymnasions): Es war zwischen zwei Anhöhen gebaut und wies
eine Länge von 196,44 m und eine Breite von 23 m auf. Die
Laufbahn war 181,30 m lang. Steinsitze sind an beiden Längsseiten
und an einer Schmalseite erhalten. Unterhalb der N-Seite führte
ein unterirdischer Gang, der in hellenistischer Zeit angelegt wurde,
zum Wohnhaus der Athleten mit einer Palästra.
Museum
Erster
Saal: Eine Abrechnungstafel über die Erbauung des
Asklepios-Tempels und der Tholos; Sammlung ärztlicher Geräte
aus Bronze und Inschriften, die Heilungen von Krankheiten
aufführen (Unfruchtbarkeit, Bandwurm, Augen-, Nieren- und
Gallenbeschwerden).
Zweiter
Saal: Asklepios- und Hygieia-Statuen; eine Rekonstruktion des
Säulengebälks des Propylon vom Gymnasion und
Giebel-Akrotere (Originale im Athener Nationalmuseum,
Epidauros-Saal).
Dritter
Saal: Skulpturenfragmente vom Asklepios-Tempel sowie
Rekonstruktion des Asklepios-Tempels und der Tholos, zu der ein
korinthisches Kapitell gehörte, das Polyklet dem Jüngeren
zugeschrieben wird; Teile der Kassettendecke und des Türrahmens
der Tholos.
Umgebung
Paläa
Epidavros (Alt-Epidauros, ca. 10 km nö): Reste des antiken
Hafens, der z. T. überflutet ist, sind noch zu erkennen. Reste
eines Theaters und einer frühchristlichen Kirche.
Texte
and Interpretationen von Heilungen
Pausanias'
Description of Epidauros (2,27,1-7)
Den
heiligen Hain des Asklepios umgeben auf allen Seiten
Grenzmarkierungen. Innerhalb der Eingrenzung darf weder jemand
sterben noch dürfen Frauen gebären. Dasselbe Verbot gilt
auch auf Delos. Die Opfergaben verzehren sie, gleichgültig ob
der Opfernde aus Epidauros oder ein Fremder ist, innerhalb der
Grenzmarkierungen. Ich weiß, dass es in Titane genauso abläuft.
Das
Kultbild des Asklepios ist halb so groß wie das des Olympischen
Zeus in Athen und ist aus Gold und Elfenbein gefertigt. Die Inschrift
besagt, dass der Bildhauer Thrasymedes aus Paros war, der Sohn des
Arignotos. Asklepios sitzt mit einem Stab in der Hand auf einem
Thron, die andere hat er über dem Kopf der Schlange; neben ihm
liegt die Figur eines Hundes. Auf dem Thron sind Taten argivischer
Helden dargestellt: die des Bellerophon gegen die Chimaira, und wie
Perseus den Kopf der Medusa abhaut
Gegenüber
vom Tempel ist der Schlafplatz derer, die Heilung vom Gott erflehen.
In der Nähe steht ein sehenswerter Rundbau aus Marmor, die
sogenannte Tholos. In ihr hat Pausias den Eros gemalt, der Pfeile und
Bogen weggelegt und stattdessen eine Leier ergriffen hat. Dort ist -
auch dieses Werk stammt von Pausias - auch gemalt, wie Methe (die
Trunkenheit) aus einer Glasschale trinkt. Man kann auf dem Bild die
Glasschale sehen und durch sie hindurch das Gesicht der Frau.
Ursprünglich standen innerhalb der Einfriedung mehrere Stelen,
zu meiner Zeit sind noch sechs übrig. Auf ihnen stehen Namen von
Männern und Frauen, die von Asklepios geheilt wurden; dazu die
Krankheit, an der jeder erkrankt war, und wie er geheilt wurde. Die
Sprachform ist dorisch.
Abgetrennt
von den übrigen steht eine alte Stele. Sie besagt, dass
Hippolytos dem Gott 20 Pferde geweiht hat. Übereinstimmend mit
der Aufschrift dieser Stele sagen die Arikier, Asklepios habe
Hippolytos, nachdem er wegen der Flüche des Theseus umgekommen
war, wieder auferweckt. Als er aber wieder lebte, wollte er seinem
Vater keine Verzeihung gewähren, sondern ging ohne Rücksicht
auf seine Bitten nach Aricia in Italien. Dort wurde er König und
stiftete Artemis einen Hain, wo bis auf meine Zeit der Preis für
den Sieger im Einzelkampf darin bestand, als Priester der Göttin
zu dienen. Zu dem Wettkampf war aber kein freier Bürger
zugelassen, nur Diener, die ihren Herren entlaufen waren
Die
Epidaurier haben im Heiligtum ein, wie ich meine, höchst
sehenswertes Theater. Die römischen Theater übertreffen
alle sonst bei weitem an prachtvoller Ausstattung, an Größe
aber das der Arkader in Megalopolis. Was aber Harmonie und Schönheit
betrifft, welcher Architekt könnte sich da verdient mit
Polykleitos messen? Denn Polykleitos war es, der sowohl dieses
Theater als auch den Rundbau errichtete. Innerhalb des Bezirks gibt
es einen Artemistempel, ein Standbild der Epione, ein Heiligtum der
Aphrodite und der Themis, ein Stadion, wie meistens bei den Griechen
eine Erdaufschüttung, und ein Brunnenhaus, sehenswert wegen
seiner Überdachung und sonstigen Ausstattung
Was
der Senator Antoninus zu unserer Zeit bauen ließ, ist ein Bad
des Asklepios und ist ein Heiligtum der Götter, die sie
"Epidotai" nennen. Er ließ auch Hygieia einen Tempel
bauen und Asklepios und Apollon, den "Ägyptern" mit
Beinamen. Es gab auch eine sogenannte "Stoa des Kotys". Sie
war aber nach dem Einsturz des Daches schon gänzlich zerstört,
weil sie aus ungebrannten Ziegeln gebaut war. Auch die ließ er
wieder aufbauen. Von den Epidauriern litten die um das Heiligtum
herum am meisten, weil ihnen die Frauen nicht unter dem Schutz eines
Daches gebären konnten, und die Kranken der Tod unter freiem
Himmel ereilte. Er half auch dem ab und richtete ein Haus ein, wo man
nunmehr sterben und wo eine Frau gebären durfte.
Zwei
Berge erheben sich über dem Hain, das Titthion und das
sogenannte Kynortion. Auf ihm ist ein Heiligtum des Apollon Maleatas.