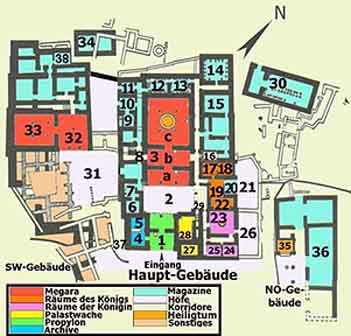Pylos
und der Palast des Nestor
Pylos,
eine kleine Stadt (ca. 3000 Einw.) liegt in einer geschützten
Bucht, die 5 km lang und 3 km breit ist. Die Insel Sphakteria
schließt diese vom offenen Meer ab. Im N und S der Insel
schmale Durchlässe für den Schiffsverkehr.
Geschichte:
Der im Mittelalter gebräuchliche Name der Stadt war Navarino,
eine Verstümmelung von »Avarinon« (»der
Awaren«, in Anspielung auf den Slaweneinfall). Der heutige Name
Pylos hat wenig mit der gleichnamigen antiken Stadt zu tun,
die weiter nördlich liegt. An der Stelle des
heutigen Pylos finden sich keinerlei antike Spuren. Das Neokastro am
Südende der Bucht errichteten die Türken 1573. 1686 bis
1715 waren die Venezianer die Herren der Festung. Während des
griech. Unabhängigkeitskriegs eroberten griech. Freiheitskämpfer
die Festung, konnten sich aber gegen Ibrahim Pascha, der 1825 die
Burg belagerte, nicht behaupten. Ibrahim schlug dort sein
Hauptquartier auf und unternahm Vergeltungsaktionen im ganzen
messenischen Land.
Die
entscheidende Wende im griech. Unabhängigkeitskampf brachte die
Seeschlacht von Navarino im Jahre 1827. Die Türken
lehnten einen Waffenstillstand mit Griechenland ab. Frankreich,
Großbritannien und Rußland, die offizielle Beziehungen
mit Griechenland unterhielten, entschlossen sich zu einer
Machtdemonstration. Die alliierte Flotte stand unter der Führung
der Admirale de Rigny, Codrington und von Heyden und verfügte
über 27 Schiffe mit 1276 Kanonen. Sie fand die
türkischägyptische Flotte im Halbkreis aufgestellt in der
Bucht von Navarino vor (89 Schiffe mit 2438 Kanonen). Bei den Türken
lösten sich einige Schüsse, die die Alliierten als
Eröffnung der Kampfhandlungen deuteten. Die Schlacht begann um
12 Uhr mittags und endete am nächsten Morgen mit der Niederlage
der Türken, die nur noch 29 Schiffe retten konnten.
Museum
in Pylos: Es besitzt Erinnerungsstücke an die Seeschlacht.
Außerdem sind Keramiken aus mykenischer Zeit und einige
hellenistische Fundstücke zu sehen.
Bucht
von Navarino: Vom Hafen aus kann man mit einem Motorboot durch
die Bucht fahren. Bei ruhigem Wasser sieht man die Wracks der
türkisch-ägyptischen Flotte auf dem Meeresboden. Im
südlichen Teil der Bucht die kleine Insel Pylos mit dem Denkmal
der in der Schlacht von Navarino gefallenen französischen
Matrosen. Die Insel Sfaktiria (5 km lang) ist unbewohnt.
Beim
Anlegeplatz Panagoula, wo eine kleine Kirche steht, das
Denkmal für die russischen Seeleute. Von dort aus kommt man zu
einem Plateau mit zwei Brunnen. Hier wurden die Spartaner im
Jahre 425 v. Chr. von den Athenern belagert, wie auch Thukydides
schreibt.
72
Tage dauerte die Belagerung, bis sich die Athener zum Angriff
entschlossen. Von den 420 Spartanern mußten sich, die noch am
Leben gebliebenen 192 ergeben.
Am
Ilias-Berg Reste einer antiken Festung, die von den Spartanern
als Zufluchtsstätte benutzt wurde. Die Sykia-Durchfahrt im N
zwischen Sfaktiria und dem Koryphasion-Vorgebirge ist ca. 100 m
breit. Überreste einer Hafenanlage aus dem 4. Jh. v. Chr.
Am Gipfel des Vorgebirges die Ruinen der Akropolis von Pylos,
die vom 6. bis zum 9. Jh. von den Awaren besetzt war. Unter den
Franken hieß sie Castel de Port dejonc. im 16. Jh.
Palaiokastro. Von der Anlage sind runde und viereckige Türme und
ein Teil des Mauerumgangs erhalten. Im N und W ist die Akropolis auf
dem antiken Unterbau aus dem 4. Jh. v. Chr. errichtet. Unterhalb der
Nordostecke der Mauer befindet sich der Eingang zur Grotte des
Nestormit Stalaktiten in Form von Tieren und Tierfellen. Der Sage
nach soll hier Hermes die von Apoll gestohlenen Rinder versteckt und
die Häute der getöteten Tiere in der Grotte aufgehängt
haben. Beim Voidokoilia-Hafen (Ochsenbauch) n des
Koryphasion-Vorgebirges ein ausgedehnter mykenischer Friedhof.
Tholos-Grab, schon im Altertum als das Grab des Thrasymedes
bekannt, mit reichen Grabbeigaben. Mitten in der Bucht die Insel
Chelonaki (kleine Schildkröte) mit dem Denkmal für die
in der Seeschlacht von Navarino gefallenen britischen Matrosen.
Palast
des Nestor
(17
km n.): Der mykenische Palast ist eine der am besten erhaltenen
Palastanlagen Griechenlands. 1939 begannen Archäologen der
Universität von Cincinnati mit systematischen Ausgrabungen in
der Gegend von Ano Englianos. Dort vermutete man den Palast
auf Grund der zahlreichen Tholos-Gräber in der näheren
Umgebung. Schon am ersten Tag der Ausgrabungsarbeiten kamen
Freskofragmente, mykenische Becher und Täfelchen mit
Linearschrift B zum Vorschein.
Geschichte:
Pylos wurde von den Neleiden beherrscht, die sich nach Nestors Vater
Neleus nannten, der aus Thessalien eingewandert war. Nestor, der
Nachfolger des Neleus, nahm mit 90 Schiffen am Trojanischen Krieg
teil und kehrte nach zehn Jahren wohlbehalten zurück.
Telemachos, des Odysseus Sohn, kam nach Pylos, als er nach seinem
Vater forschte, und wurde königlich bewirtet, bevor er zu
Menelaos nach Sparta reiste. Der Palast wurde im 13. Jh. erbaut und
gegen 1200 v. Chr. durch einen Brand zerstört.
Palast:
Er besteht aus einer Reihe von Gebäuden. Der Hauptbau mit 50m
Länge und 32 m Breite war der Wohnsitz des Königs. Im SW
vom Hauptbau ein weiterer, kleinerer Wohntrakt. Im NO ein länglicher
Bau, der als Palastwerkstatt angesehen werden kann. Auf Grund von
Funden wurden dort Leder- und Metallgegenstände repariert. Nw
von der Werkstatt befanden sich weitere Räume, in denen
wahrscheinlich die Sklaven wohnten.
Der
Palast war zweistöckig angelegt; Treppen führten zum
zweiten Stock hinauf, wo sich die Frauengemächer
befanden. Dach wie Wände waren aus Holz gefertigt, ebenso die
Säulen und die Türrahmen. Die Innenwände waren
stuckiert und bemalt.
|
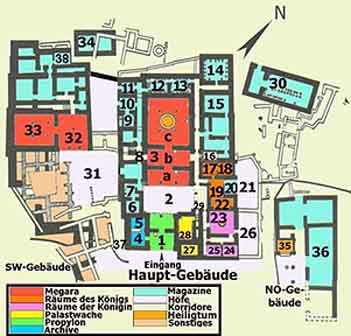
|
Hauptgebäude:
1. Propylon
2. Hof zum Megaron
3. Megaron
3a.+3b. Vorhallen
3c.Thronsaal mit Opferherd
4. + 5.
Archiv (Linear-B-Täfelchen)
6. Vorratskammer
7.
Warteraum
11. Treppe
9.-15.Geräteräume +
Ölmagazine (Gefäßfunde)
16. Treppe
17.-19.
Gemächer des Königs
22: Badezimmer
|
23.
Megaron der Königin
24.-25. Wohnräume der Königin
26. Hof der Königin
27.-28. Räume der Palastwache
31. Vorhalle mit Treppe zum Obergeschoss und Zugang zu den
Nebenräumen
30. Weinmagazin
SW-Gebäude
(Älterer Palast):
31. Hof
37: Rampe
32.Vorraum zum Megaron (Aithusa)
33. Megaron (Domos)
34.
Weinlager
NW-Gebäude (Werkstätten)
35.
Kleines Heiligtum
36. Werkstatt
|
Hauptgebäude:
Der Eingang (Propylon) befand sich im SO. Links zwei kleine Räume
(Archive), wo man ca. tausend Tontafeln mit Linearschrift B
ausgrub. M. Ventris und J. Chadwick gelang es 1952, die Schrift
zu entziffern; die Sprache ist ein Vorläufer des Altgriech!
Diese Tafeln von ca. 7 x 12 bis 25 cm Größe enthalten
Aufzeichnungen in Registerform, eine Art Inventarliste von Waren,
Geräten und Gefäßen. Andere wiederum geben Auskunft
über Namen und Herkunftsorte der Lieferanten. Nach Passieren des
Propylons gelangt man in einen Hof an dessen Ende sich
ein Portikus öffnete. Zwei Holzsäulen trugen das Gebälk
dieser Vorhalle. Auf der linken Hofseite zwei Räume: eine
Speisekammer und ein Warteraum für die Gäste, die den König
besuchen wollten. Der Warteraum hatte eine umlaufende Bank; die Wände
waren mit Malereien usgeschmückt. Zwei Wein-Pithoi standen in
einer Ecke. Im anderen Raum fand man Hunderte von Weingefäßen,
die noch an Ort und Stelle zu sehen sind. Durch eine zweite Halle (5)
gelangte man in den Thronsaal mit einer Fläche von 11,20
x 12,90m. In der Mitte des Raums befand sich ein großer Herd
mit einem Durchmesser von 4 m. Vier Holzsäulen stützten
das Dach. Für den Rauchabzug über dem Herd sorgten
Tonröhren, die bei den Ausgrabungsarbeiten gefunden wurden. Ein
Opfertisch befand sich links vom Herd. Der Thron
stand erhöht an der rechten Wand des Saales. Er war
wahrscheinlich aus Holz gefertigt und mit Einlegearbeiten in
Elfenbein verziert. Der erhaltene Wandschmuck des Thronsaals zeigt
einen Greifen und einen Löwen sowie einen auf einem
Felsen sitzenden Leierspieler. Der Fußboden aus
Stuck war in quadratische, ornamentierte Felder aufgeteilt. Vor dem
Thron die Darstellung eines Tintenfisches. Neben dem Thron an der
rechten Seite eine Vertiefung für Trankopfer. Auf diese Weise
konnte der König vom Thron aus die Opfer darbringen.
Links
vom Thronsaal Magazinräume, in denen man vorwiegend Gefäße
fand. Direkt hinter dem Thronsaal zwei große Vorratsräume
zur Lagerung von Öl. Von den Vorratsräumen gelangt man zu
einem weiteren Ölvorratsraum.
Rechts
vom Thronsaal fünf weitere Räume verschiedener Größe.
Einer von ihnen kann als Ölmagazin angesprochen werden, da in
ihm bemalte Vorratsgefäße gefunden wurden. Die anderen
Räume scheinen zum Zeitpunkt des Brandes leergestanden zu haben.
Nur in einem fand man Reste von verbranntem Elfenbein.
Wieder
in der Halle, sieht man rechts 8 Stufen, die zum oberen
Stockwerk führten. Insgesamt müßten es 21 Stufen
gewesen sein. Somit ergibt sich eine Höhe von ca. 3,25 m für
das Erdgeschoß. Auf der linken Seite der Halle Reste von zwei
weiteren Treppen.
Rechts
vom Hof ein großer Raum, vielleicht das Privatgemach des
Königs. Ebenfalls vom Hof aus gelangt man zu einem Bad .
Es ist das einzige erhaltene aus mykenischer Zeit auf dem Festland.
Die Tonwanne ist bemalt, davor ein Tritt zum Einstieg. Seitlich ein
Podest
für die Wassergefäße. Vom Hof aus nach rechts ein
größerer Raum mit Herd, der Saal der Königin .
Reste von Wandmalereien mit der Darstellung von Greifen, Löwen
und Leoparden.
Gebäude
im S W: Es handelt sich um die Ruinen eines weiteren Palastes
aus dem Späthelladikum III A (älter als der Hauptpalast,
der im Späthelladikum III B anzusetzen ist). Ein Hof trennte die
beiden Paläste. Durch einen großen Raum mit zwei Säulen
am Eingang und einer in der Mitte gelangte man zum älteren
Thronsaal, der aber keinen Herd besaß. Der nördlichste
Raum des Trakts diente als Weindepot.
Gebäude
im NW: Es diente in erster Linie als Werkstatt. Ein kleiner Raum kann
als kleines Heiligtum angesehen werden; davor Reste eines Altars. Ein
weiterer Raum diente vielleicht als Lager für Rohmaterial (viele
Bronzefragmente). Der mittlere Raum war die eigentliche Werkstatt.
Dort fand man 56 Tontäfelchen mit Angaben über Reparaturen
von Leder oder Metall und über Lieferungen von beiden
Materialien Der große Raum im NO der Palastanlage war das
Weindepot.
Tempelgräber.
100 m nö vom Palast ein Tholos-Grab von 9,35 m Durchmesser, das
zwar ausgeplündert war, in dem aber noch wertvolle Gegenstände
wie Goldringe, Amethyststeine und Gemmen gefunden werden konnten.
Weitere Gräber liegen in der Umgebung der Palastanlage verstreut
(ebenfalls mit zahlreichen Funden).
Museum
des Nestor Palastes in Chora (ca. 3 km nö): Fresken,
Tongeschirr, Tontäfelchen und aus der Umgebung ein Goldbecher
(aus dem Grab von Peristeria bei Kyparissia).